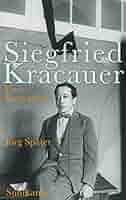Ein stiller Selbstdenker erwacht zu neuem Leben
Jörg Späters monumentale Biographie über Siegfried Kracauer (rund 750 Seiten) ist zunächst gewöhnungsbedürftig – wer rechnet schon damit, dass die Lebensgeschichte eines Architekten-Feuilletonisten-Filmtheoretikers derart packend werden kann? Doch genau das gelingt dem Freiburger Historiker: Er erweckt einen stillen, stotternden, wenig sichtbaren Selbstdenker zu neuem Leben.
Kracauer verkörpert einen bewussten Grenzgänger: ein Intellektueller, der aus gefühlter Einsamkeit und prekären Verhältnissen heraus in Spezialistenkreisen innoviert und dabei gesellschaftliche Tiefenstrukturen freilegt. Später zeigt, wie dieser „pan-optische Deuter der Moderne“ aus großem intellektuellem Drang die „unscheinbaren Oberflächenäußerungen“ seiner Zeit – Filme, Tänze, Ornamente – zu epochalen Diagnosen destilliert. Keine Heldengeschichte, sondern das Porträt eines Außenseiters zwischen den Disziplinen.
Die Bewegtheit der Biographie entspringt Kracauers dreifachen Neuanfängen: Frankfurt-Berlin als Architekt und Feuilletonist, gut vernetzt, das entbehrungsreiche Pariser Exil, schließlich New York ab 1941 – mit 52 Jahren das dritte neue Leben. Später schildert diese Brüche nicht als Katastrophen, sondern als Metamorphosen eines Denkens, das sich stets neu erfinden musste.
Späters soziale Biographie folgt Kracauers eigener Methode: Detail- und Nahaufnahmen statt Totale. Der Historiker variiert geschickt zwischen wissenschaftlichem und romanhaftem Ton, nutzt sogar Mimikry an Kracauers autobiographische Romane. Diese literarische Komposition macht über 600 Seiten zu einem überraschend anregenden Spaziergang.
Was als Lektüre außerhalb des angestammten Interessengebiets beginnt, wird zunehmend fesselnder – durch die Intensität eines Lebens in prekären Verhältnissen, durch einen Intellektuellen, der sich immer wieder in völlig neuen Umgebungen zurechtfinden musste. Später gelingt es, Kracauers „reaktiven Gestus“ – das Vielleicht statt des entschiedenen Urteils – als Stärke zu würdigen.
Fazit
Eine längst überfällige, materialreiche Pionierarbeit (von 2016), die zeigt: Manchmal sind es gerade die Randfiguren, die das Zentrum ihrer Zeit am schärfsten erfassen. Später hat nicht nur die erste umfassende Kracauer-Biographie geschrieben, sondern ein intellektuellengeschichtliches Epochenbild des 20. Jahrhunderts.