„Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes“ aus der C.H. Beck Wissen-Reihe bietet eine kompakte, aber fundierte Darstellung des deutschen Bauernkriegs von 1524/25. Das Buch zeichnet sich durch mehrere zentrale Aspekte aus, die der Experte für Bauernkriegsforschung Peter Blickle kompakt und mit vielen Originaltönen darlegt. So heißt es gleich zu Beginn des ersten Kapitels:
„Solche Uffrur“ wie jener von 1525 „ist mit Tyrrani gelegt und gestillet worden„, urteilte Johannes Stumpf, ein Pfarrer im Zürcher Oberland und ein Freund des Schweizer Reformators Huldrich Zwingli. „Dan Tyrrani und Uffrur gehören zusamen, es ist Deckel und Hafen.“
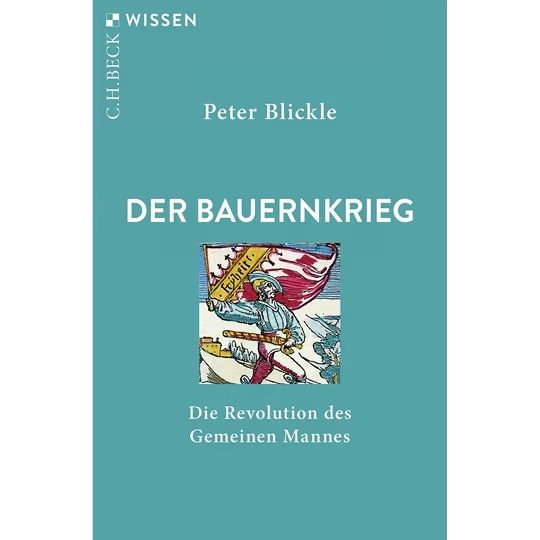
Peter Blickle: Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, C.H. Beck Wissen, München, erschien erstmals 1998, liegt inzwischen in der 6. Auflage (2025) vor, 144 Seiten.
Blickles Grundthese: Er interpretiert den Bauernkrieg nicht nur als agrarischen Aufstand, sondern als umfassende gesellschaftliche Revolution des „Gemeinen Mannes“ – ein Begriff, der alle nicht-privilegierten Schichten umfasst, also Bauern, Handwerker und städtische Unterschichten.
Ursachen und Vorgeschichte: Blickle analysiert die komplexen Ursachen des Aufstands: wirtschaftliche Verschlechterungen und unerträgliche Abgaben an die Herrscher, rechtliche Benachteiligungen, religiöse Reformimpulse durch Luther sowie das erwachende politische Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung.
Verlauf und regionale Unterschiede: Er schildert den chronologischen Ablauf der Erhebungen von Südwestdeutschland bis nach Thüringen und zeigt die regionalen Besonderheiten auf – von den relativ gemäßigten Forderungen im Südwesten bis zu den radikaleren Bewegungen um Thomas Münzer.
Die Zwölf Artikel: Besondere Aufmerksamkeit widmet Blickle diesem zentralen Forderungskatalog der Bauern, den er als ersten Versuch einer verfassungsrechtlichen Formulierung von Menschenrechten interpretiert.
Für Strafrecht, Zivilrecht und Polizeirecht bedeutete die Landesordnung einen enormen Modernisierungsschub – eines der fortschrittlichsten Länder, das Tirol zweifellos war, erhielt die ihm kongeniale Rechtsordnung durch die Rationalisierung gerichtlicher Verfahren, die Verbesserung der Besitzrechte für die Bauern (Erbrecht) und die stärkere staatliche Kontrolle der kräftig expandierenden Wirtschaft.
Scheitern und Folgen: Er erklärt die militärische Niederlage der Bauern und analysiert die langfristigen Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaftsentwicklung. Trotz der militärischen Niederlage setzten einige Verhandlungsverträge überraschend verfassungsrechtlich relevante Rechte für die Untertanen fest – mit Nähe zu modernen Menschen‑ und Bürgerrechten
Diskurs über Freiheit: Die Aufständischen entfachten einen öffentlichen Diskurs über Freiheit und Gerechtigkeit. Hätten ihre Forderungen den Erfolg gehabt, wäre dies eine tiefgreifende republikanische Reform gewesen, mit städtischer und kommunaler Selbstbestimmung. Entsprechend waren die politischen Programme kommunal, korporativ und bündisch geprägt.
Fazit: Blickles Darstellung ist geprägt von seinem Verständnis des Bauernkriegs als frühmoderner Revolution, die weit über rein ständische Interessen hinausging und grundlegende Fragen von Herrschaft, Recht und gesellschaftlicher Ordnung – insbesondere von unten, von den Menschen und Gemeinden ausgehend – aufwarf.
Peter Blickle (1938-2017) war ein renommierter deutscher Historiker und einer der führenden Experten für die Geschichte der Frühen Neuzeit, insbesondere des Bauernkriegs von 1525. Er lehrte als Professor an der Universität Saarbrücken und später an der Universität Bern. Blickle prägte maßgeblich die moderne Bauernkriegsforschung und entwickelte innovative Interpretationsansätze zu den sozialen Bewegungen des 16. Jahrhunderts.